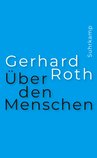 Seit einiger Zeit kann man einen sich zuspitzenden Streit um die Deutungshoheit über den Menschen verfolgen, der zwischen den Vertretern der Geisteswissenschaften und denen der Neurowissenschaften ausgetragen wird. Die einen begreifen den menschlichen Geist nicht als etwas, das man naturwissenschaftlich ergründen könne, während die Naturwissenschaftler mit Vehemenz genau diesen Forschungsansatz vertreten und beklagen, dass viele Geisteswissenschaftler die Ergebnisse der Hirnforschung ignorierten.
Seit einiger Zeit kann man einen sich zuspitzenden Streit um die Deutungshoheit über den Menschen verfolgen, der zwischen den Vertretern der Geisteswissenschaften und denen der Neurowissenschaften ausgetragen wird. Die einen begreifen den menschlichen Geist nicht als etwas, das man naturwissenschaftlich ergründen könne, während die Naturwissenschaftler mit Vehemenz genau diesen Forschungsansatz vertreten und beklagen, dass viele Geisteswissenschaftler die Ergebnisse der Hirnforschung ignorierten.
Um diesem fruchtlosen Streit die Spitze zu nehmen und mit der weiteren Absicht, eine Brücke zu schlagen zwischen den zerstrittenen Lagern, hat Gerhard Roth, der von den Geisteswissenschaften kommt, aber schon lange einer der renommiertesten und wirkungsmächtigsten Vertreter der Neurowissenschaften ist, ein auf verständlichere Weise als in seinen wissenschaftlichen Publikationen geschriebenes Buch veröffentlicht mit dem Titel „Über den Menschen“ − ein mit Bedacht gewählter Titel in Anlehnung an das gleichlautende Werk des Philosophen René Descartes, der darin der Frage nachging, wie die Beziehung zwischen Geist und Materie beschaffen sei. Dieses Problem kennt die Philosophiegeschichte seither unter dem Begriff des Dualismus, das nach Meinung vieler Philosophen und Wissenschaftler bis heute noch nicht gelöst und möglicherweise auch nicht lösbar ist. Roth stellt sich auch dieser Herausforderung, indem er im Vorwort zu seinem Buch schreibt, dass Leser beurteilen mögen, „ob wir inzwischen unter Beteiligung der Neurowissenschaften über Descartes und seine Philosophie hinausgegangen sind“.
Bevor dieses spannende Thema in den Fokus dieser Besprechung rückt, gilt es zunächst, ein uneingeschränktes Lob auszusprechen. Roths Fähigkeit, hochkomplexe Ergebnisse der Hirnforschung dem Leser so darzubieten, dass er den Ausführungen nicht nur folgen kann, sondern dabei auch etwas von der Faszination der Tätigkeit des Neurowissenschaftlers spürt, ist keine Selbstverständlichkeit. Sein leserfreundliches Buch kann auch durch seine übersichtliche Struktur punkten. In 13 Kapiteln mit jeweils sehr griffigen, aussagekräftigen Überschriften („Wie wir werden, was wir sind“, „Das Ich − Herr oder Knecht“, „Das Geist-Gehirn-Problem: ‘Gelöst, lösbar oder unlösbar‘?“) handelt Roth seine Themen ab, wobei jedem Kapitel eine kurze thematische Übersicht vorangestellt ist. Hilfreich ist auch, dass Roth die wichtigsten Aussagen jedes Kapitels unter der jeweiligen Fragestellung „Was sagt uns das?“ am Schluss in wenigen Sätzen zusammengefasst hat.
Was also sagt uns Roth in diesem Buch, dessen übergreifende Fragestellung lautet, „ob und in welcher Weise neurowissenschaftliche Erkenntnisse (. . .) dazu beitragen können, ein umfassenderes Menschenbild zu entwerfen“? Die erste Korrektur diesbezüglich findet sich gleich im ersten Kapitel und lautet: Der Mensch ist im Vergleich mit den Tieren nichts Besonderes, wie in der Geistesgeschichte lange vermutet wurde, da seine Gehirnstrukturen und -funktionen sich nur quantitativ von denen seiner nächsten tierischen Verwandten unterschieden. Gleichwohl muss aber auch die Neurowissenschaft konstatieren, dass die kognitiven Fähigkeiten des Menschen diejenigen von Hominiden aufgrund der Größe und Komplexität seines neuronalen Netzwerks bei weitem übertreffen. Hier wäre natürlich zu fragen, ob dieser Tatbestand nicht doch eine neue Qualität bedeutet, die sich auch angesichts dessen aufdrängt, dass nur der Mensch so etwas wie ein Ich-Bewusstsein, d.h. ein Bewusstsein seiner selbst ausbildet, während Tiere zweifelos auch ein Bewusstsein besitzen, jedoch keines mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Darüber hinaus ließen sich auch als weitere Alleinstellungsmerkmale des Menschen dessen komplexe Sprache und Kommunikationsfähigkeit und die darauf basierenden Kulturleistungen ins Feld führen, die den Menschen in einer evolutionären Reihe mit den Tieren doch in besonderer Weise auszeichnen, ohne dass damit zwingend eine hierarchische Bewertung von Tier und Mensch verbunden sein muss. Roth erwähnt in dem entsprechenden Kapitel („Von dem Wunsch des Menschen, etwas Besonderes zu sein“) zwar die hochentwickelte Sprache des Menschen, nicht aber die genannten außergewöhnlichen Kulturleistungen. Vermutlich tut er sich damit schwer, da bei so komplexen geistigen Leistungen eine direkte kausale Beziehung zu Hirnvorgängen schwer nachzuweisen sein dürfte, seine Argumentationslogik in diesem Buch aber genau dem strikten Ziel zu folgen scheint, alles, was den Menschen ausmacht, mit dem in Verbindung bringen zu können, was die Neurowissenschaft durch ihre Analysen der Gehirnvorgänge bis heute erkannt hat.
Und das ist nicht wenig. So erläutert Roth in einem Kapitel die These, dass die Psyche und die Persönlichkeit des Menschen enger mit der Entwicklung des Gehirns zusammenhingen als früher gedacht, wobei er sich vor allem auf die unbewussten Prägungen des Gehirns wie auch auf die durch Sozialisationsprozesse zustande kommenden Einflüsse auf unser zentrales Organ konzentriert. Rundherum abgelehnt wird von Roth in diesem Zusammenhang das auch von Goethe vertretene Konzept einer Selbstverwirklichung des Menschen, das die durch das Gehirn gesetzten Grenzen ignoriere. Mit der gleichen Begründung negiert der Hirnforscher auch die Behauptung eines freien Willens und stellt demgemäß die geistesgeschichtliche Vorstellung eines menschlichen Ich als Akteur und Träger unser geistigen Aktivitäten in Frage. Stattdessen produziere das Gehirn, angestoßen durch die Wirklichkeitswahrnehmung, permanent verschiedene Ichzustände, die dem Bild einer festen Ich-Identität, wie es sich vor allem die Philosophen des deutschen Idealismus gedacht haben, widersprächen.
Wenn hier Roth von dem Gehirn als einem Grenzen setzenden Organ spricht, das die Vorstellung eines freien Willens im strengen Sinn oder die einer Selbstverwirklichung des Menschen nicht zulässt, dann spricht er von materiellen Bedingtheiten geistiger Prozesse. Ausdrücklich verneint er jedoch den Gedanken eines biologischen Reduktionismus. Demgemäß sieht Roth den Geist selbst nicht als etwas Eigenständiges, sondern immer als an materielle Gehirnvorgänge gebunden an. „Wir müssen Geist als einen physikalischen Zustand akzeptieren und uns von der Vorstellung verabschieden, er sei etwas ‚Übernatürliches’“, so hat dies Roth in dem Kapitel über das Geist-Gehirn-Problem ausgedrückt. Diese Vorstellung verweist er in den Bereich der Metaphysik. Geist, wie er ihn versteht, sei wissenschaftlich nur physikalisch zu ergründen. Das Wesen des Geistes, wie ihn Philosophen fokussierten, könnten wir Menschen nie bestimmen, es sei naturwissenschaftlich obsolet geworden, so Roth in einem Gespräch der Reihe „Sternstunden der Philosophie“ des Schweizerischen Fernsehens.
Spätestens hier sollte deutlich geworden sein, warum der eingangs erwähnte Streit um die Deutungshoheit über den Menschen zwischen den Geisteswissenschaftlern und den Vertretern der Neurowissenschaften ausgebrochen ist, und man fragt sich zu Recht, ob und wie Roth mit dem in seinem Buch unternommenen Vermittlungsversuch erfolgreich sein kann. Zweifel sind angebracht. Denn so sehr dessen Versuch, zwischen den oppositionellen Lagern zu vermitteln, zu begrüßen ist, so wenig überzeugt mag man von dem sein, wie er das in seinem Buch umgesetzt hat. Zwar trägt Roth darin geistesgeschichtliche Positionen zu bestimmten Themen und Problemem im Zusammenhang mit der Deutung des Menschen vor, um sie dann jedoch allesamt als nicht mehr relevant bzw. obsolet ad acta zu legen. Und von den Geisteswissenschaftlern erwartet er vor allem, dass sie den Gedanken akzeptierten, alles Geistige sei gehirnbasiert. Der ehemalige Geisteswissenschaftler Roth scheint Kulturleistungen des Menschen wie das Schreiben eines Romans, das Komponieren eines Musikstücks oder das Schreiben eines philosophischen Essays und deren Wirkungen auf den Hörer und Leser als nicht relevant für ein weitgehend neurowissenschaftlich ausgerichtetes Menschenbild zu halten. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass Kulturleistungen wie die genannten nicht durch Analysen von Gehirnvorgängen in ihrer Bedeutung für den Menschen als geistigem Wesen begreifbar werden?
Mein Fazit der Lektüre von Roths Buch fällt geteilt aus: Einerseits habe Ich sehr viel Neues und Faszinierendes gelernt über die Funktionalität des Gehirns. Weitgehend gesichert scheint mir die Grundthese der Neurowissenschaften, dass alles Geistige seinen Ursprung im Gehirn hat. Ob das aber auch heißt, dass damit der Descartsche Dualismus von Geist und Materie durch die Hirnforschung überwunden ist, muss nach dieser Lektüre weiterhin offenbleiben. Gut ist, dass der Verfasser die Grenzen der neurowissenschaftlichen Forschung durch die Darstellung ihrer Methoden und Ergebnisse deutlich gezogen hat. Ob sich innerhalb dieser Grenzen die Frage nach einem neuen Menschenbild, wie es Roth im Schlusskapitel skizziert, beantworten lässt, das wage ich doch zu bezweifeln, da ich der Überzeugung bin, dass sich dieses nicht zusammensetzen lässt aus noch so vielen Analysen von Gehirnvorgängen, sondern immer nur über das vermittelt, was durch diese Vorgänge entsteht und worum sich die Geisteswissenschaften kümmern: das geistige Ergebnis. Roth sieht diese in ihrem Selbstverständnis einer verstehenden Wissenschaft aber nicht auf Augenhöhe mit der Neurowissenschaft, der ihm zufolge eigentlichen Geisteswissenschaft als einer naturalistisch basierten Wissenschaft. Insofern geht der von Roth mit diesem Buch beabsichtigte Brückenschlag zwischen den Neurowissenschaften und den Geisteswissenschaften leider ins Leere, da er keinen anderen wissenschaftlichen Zugriff auf den Geist als den neurophysiologischen zu akzeptieren scheint.
Gerhard Roth: Über den Menschen. Suhrkamp Verlag Berlin 2021. 26 €.
© Kurt Frech
