
Über den Menschen
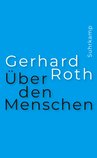 Seit einiger Zeit kann man einen sich zuspitzenden Streit um die Deutungshoheit über den Menschen verfolgen, der zwischen den Vertretern der Geisteswissenschaften und denen der Neurowissenschaften ausgetragen wird. Die einen begreifen den menschlichen Geist nicht als etwas, das man naturwissenschaftlich ergründen könne, während die Naturwissenschaftler mit Vehemenz genau diesen Forschungsansatz vertreten und beklagen, dass viele Geisteswissenschaftler die Ergebnisse der Hirnforschung ignorierten.
Seit einiger Zeit kann man einen sich zuspitzenden Streit um die Deutungshoheit über den Menschen verfolgen, der zwischen den Vertretern der Geisteswissenschaften und denen der Neurowissenschaften ausgetragen wird. Die einen begreifen den menschlichen Geist nicht als etwas, das man naturwissenschaftlich ergründen könne, während die Naturwissenschaftler mit Vehemenz genau diesen Forschungsansatz vertreten und beklagen, dass viele Geisteswissenschaftler die Ergebnisse der Hirnforschung ignorierten.
Was alles kann ein Computer?
 Der „Zeit"-Redakteur Dieter E. Zimmer, der als Sachbuchautor schon mehrfach bewiesen hat, dass er nicht nur eine exzellente Sachkenntnis besitzt, sondern diese auch in eine lesenswerte Form umzusetzen versteht, hat seinen beiden Büchern über Sprache („Redens Arten", „So kommt der Mensch zur Sprache") vor kurzem ein weiteres folgen lassen, das jetzt als Taschenbuch vorliegt.
Der „Zeit"-Redakteur Dieter E. Zimmer, der als Sachbuchautor schon mehrfach bewiesen hat, dass er nicht nur eine exzellente Sachkenntnis besitzt, sondern diese auch in eine lesenswerte Form umzusetzen versteht, hat seinen beiden Büchern über Sprache („Redens Arten", „So kommt der Mensch zur Sprache") vor kurzem ein weiteres folgen lassen, das jetzt als Taschenbuch vorliegt.
Moral zwischen Politik und Alltag
 „Schluß mit der Moral” – der Titel des „Kursbuchs” mag irritieren. Beklagt unsere Gesellschaft nicht eine schleichende Erosion der Moral? Müsste die nicht gerade eingefordert werden? Das „Kursbuch” konzentriert sich auf die öffentliche und offizielle Moralproduktion, die auf die Krise des moralischen Bewusstseins reagiert – mit überwiegend zweifelhaften Ergebnissen, wie die Beiträge belegen.
„Schluß mit der Moral” – der Titel des „Kursbuchs” mag irritieren. Beklagt unsere Gesellschaft nicht eine schleichende Erosion der Moral? Müsste die nicht gerade eingefordert werden? Das „Kursbuch” konzentriert sich auf die öffentliche und offizielle Moralproduktion, die auf die Krise des moralischen Bewusstseins reagiert – mit überwiegend zweifelhaften Ergebnissen, wie die Beiträge belegen.
Zeitgewinn fürs Lesen
 Eine solche Geschichte der deutschen Literatur hat es zweifellos noch nicht gegeben. Sie kommt mit 157 Seiten aus, während andere Literaturgeschichten in aller Regel mehrbändig sind. Aber auch sonst fällt „Die kurze Geschichte der deutschen Literatur" aus dem Rahmen.
Eine solche Geschichte der deutschen Literatur hat es zweifellos noch nicht gegeben. Sie kommt mit 157 Seiten aus, während andere Literaturgeschichten in aller Regel mehrbändig sind. Aber auch sonst fällt „Die kurze Geschichte der deutschen Literatur" aus dem Rahmen.
Erika Manns Erinnerungen an ihren Vater
 Die Gnade war spürbar. Wer immer ihn gesehen hat, gegen Ende, wer in Stuttgart dabei war oder in Weimar; in Lübeck, Kilchberg oder Zürich; in Amsterdam oder im Haag, hat sie gespürt, die Heiligkeit, die von ihm kam und die jede seiner Wirkungen bestimmte . . . Doch weder durch Talent, noch Können, noch durch die Summe beider erklärt sich die ungemeine Ergriffenheit, die er auslöste, besonders in der letzten Zeit. Was da die Menschen berührte und sie fast ausnahmslos für sich einnahm, war die Persönlichkeit mit ihren Rätseln, deren tiefstes und höchstes im Falle dieses Achtzigjährigen nicht anders zu benennen ist als „Gnade”.
Die Gnade war spürbar. Wer immer ihn gesehen hat, gegen Ende, wer in Stuttgart dabei war oder in Weimar; in Lübeck, Kilchberg oder Zürich; in Amsterdam oder im Haag, hat sie gespürt, die Heiligkeit, die von ihm kam und die jede seiner Wirkungen bestimmte . . . Doch weder durch Talent, noch Können, noch durch die Summe beider erklärt sich die ungemeine Ergriffenheit, die er auslöste, besonders in der letzten Zeit. Was da die Menschen berührte und sie fast ausnahmslos für sich einnahm, war die Persönlichkeit mit ihren Rätseln, deren tiefstes und höchstes im Falle dieses Achtzigjährigen nicht anders zu benennen ist als „Gnade”.
Götzes „Immer Paris“
 Walter Benjamin hat Paris die „Hauptstadt des 20. Jahrhunderts” genannt und damit ihre große Bedeutung für die Entwicklung der europäischen Moderne pointiert gewürdigt. Für das gerade begonnene 21. Jahrhundert kann diese Zuspitzung so nicht mehr gelten – andere europäische Metropolen wie London, Brüssel, Madrid oder Frankfurt konkurrieren heute mit Paris.
Walter Benjamin hat Paris die „Hauptstadt des 20. Jahrhunderts” genannt und damit ihre große Bedeutung für die Entwicklung der europäischen Moderne pointiert gewürdigt. Für das gerade begonnene 21. Jahrhundert kann diese Zuspitzung so nicht mehr gelten – andere europäische Metropolen wie London, Brüssel, Madrid oder Frankfurt konkurrieren heute mit Paris.