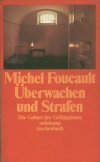 Hatten Horkheimer und Adorno die Vernunft der abendländischen Philosophie angesichts ihrer im Prozess der Moderne voranschreitenden Verkümmerung zur instrumentellen noch dialektisch zu retten versucht, machten in den sechziger Jahren einige vom Strukturalismus beeinflusste Philosophen aus Frankreich mit ihr kurzen Prozess.
Hatten Horkheimer und Adorno die Vernunft der abendländischen Philosophie angesichts ihrer im Prozess der Moderne voranschreitenden Verkümmerung zur instrumentellen noch dialektisch zu retten versucht, machten in den sechziger Jahren einige vom Strukturalismus beeinflusste Philosophen aus Frankreich mit ihr kurzen Prozess.
Diesen galt sie nicht mehr als Garant von Humanität und Fortschritt, sondern als entscheidende Begründungsinstanz zur Ausgrenzung und Unterdrückung des Anderen der Vernunft. Ihr Wortführer war der 1984 verstorbene Michel Foucault, der in seinem grundlegenden Werk „Die Ordnung der Dinge" eine vernunftkritische Geschichtsschreibung der Humanwissenschaften theoretisch begründete und in materialen Studien exemplarisch umsetzte.
Zu ihnen zählt sein Buch „Überwachen und Strafen", das jetzt neu aufgelegt wurde. Darin rekonstruiert er die gesellschaftlichen und politischen Prozesse an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, die zur Entstehung des Gefängnisses führten. Dabei interessiert sich Foucault vor allem für die neue Theorie des Rechts und des Verbrechens und die neue moralische und politische Rechtfertigung der Strafe, die in eine neue Strafpraxis mündete.
Sie brachte ein Ende der oft grausamen körperlichen Züchtigung, der Marter, die der Delinquent als Rache des fürstlichen Souveräns erleiden musste, und eine Milderung der Strafen. Doch was den Beginn des humanen Strafvollzugs darstellte, ist für Foucault zugleich der Versuch des bürgerlichen Staates, seine Verfügungsgewalt über den Gesetzesbrecher zu perfektionieren. Dabei bedient er sich vor allem pädagogischer und psychologischer Methoden als Mittel einer allumfassenden Disziplinierung. Die Isolierung der Straftäter in Gefängniszellen wird ihr sinnfälliger Ausdruck. In dieser „Doppelbewegung von Befreiung und Versklavung" erkennt Foucault die eigentliche Logik des Humanismus, wie Habermas meint: dessen innere Verwandtschaft mit dem Terror.
Jenseits grundsätzlicher Einwände, die Foucaults unerbittliche Modernitätskritik provoziert hat, bleibt seine Studie über die Geburt des Gefängnisses beeindruckend: wegen der Fülle an aufschlussreichen Quellen und Dokumenten, die zu einer ebenso informativen wie schonungslosen Analyse dieser „totalen Institution" verarbeitet werden, aber auch durch eine übersichtliche Darstellung und brillante Formulierungen – nicht eben eine Selbstverständlichkeit bei solcher Art wissenschaftlicher Literatur.
Michel Foucault: „Überwachen und Strafen". Suhrkamp Taschenbuch. 397 Seiten. 16.80 DM.
