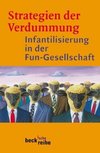 Bei der Spaßgesellschaft, von der in letzter Zeit immer öfter die Rede ist, hört der Spaß auf. Das jedenfalls finden die heute rar gewordenen Intellektuellen, die noch immer nicht von der Aufklärung lassen wollen. Doch in einer Zeit, wo alles gleich gültig zu sein scheint, gegen die Gleichgültigkeit des Denkens anzuschreiben, ist schwer, wenn nicht gar unmöglich. Denn die Pluralität von Standpunkten, wie sie in der Postmoderne gegeben ist, lässt eine Kritik mit dem Anspruch auf Verallgemeinerungsfähigkeit nicht mehr zu. Sie bleibt kontingent.
Bei der Spaßgesellschaft, von der in letzter Zeit immer öfter die Rede ist, hört der Spaß auf. Das jedenfalls finden die heute rar gewordenen Intellektuellen, die noch immer nicht von der Aufklärung lassen wollen. Doch in einer Zeit, wo alles gleich gültig zu sein scheint, gegen die Gleichgültigkeit des Denkens anzuschreiben, ist schwer, wenn nicht gar unmöglich. Denn die Pluralität von Standpunkten, wie sie in der Postmoderne gegeben ist, lässt eine Kritik mit dem Anspruch auf Verallgemeinerungsfähigkeit nicht mehr zu. Sie bleibt kontingent.
Dieser Problematik sind sich die Herausgeber des Buches „Strategien der Verdummung" bewusst. Gleichzeitig halten sie die Publikation von Beiträgen, in denen der Infantilisierung in der Spaßgesellschaft auf den Grund gegangen wird, für wichtig, weil sie davon überzeugt sind, dass Demokratie ohne mündige Subjekte und ohne Kritik nicht überleben könne und es nach wie vor um den Wahrheitsgehalt von Diskursen gehe und nicht allein um deren mediale Macht.
Dabei scheint der Wahrheitsgehalt des Buches selbst außer Frage zu stehen. Denn dass die Verdummung in der Gesellschaft mit nicht unmaßgeblicher Hilfe vieler Massenmedien, vor allem des kommerziellen Fernsehens, voranschreitet, wer, der noch bei Verstand ist, möchte das bestreiten? Oder glaubt irgend jemand, dass die täglich gesendeten Talkshows, Reality-Soaps, Comedyshows und Sensationsreportagen und was dergleichen quotenfixierte Produzenten der Spaß- und Zerstreuungskultur sich noch ausdenken, intelligenzvermehrend sind?
Doch nicht allein das Fernsehen ist im Fokus der Kritik. Andere „dumme Sinnsysteme" wie das postmoderne Kauderwelsch in manchen Wissenschaften, der gängige Begriff des Wissens in der Informationsgesellschaft, die Information mit Wissen verwechselt, und die Feier der Ich-Abdankung in der Esoterik werden ebenfalls angeprangert, weil sie zwar vom Komplexitäts- und Rationalitätsdruck der modernen Welt entlasteten, was sie für die meisten Menschen so attraktiv mache, aber die Fähigkeit zum kritischen Urteil zerstörten. Überraschen mag, dass in der Philippika gegen die Dummheit auch Intellektuelle nicht ungeschoren davonkommen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie an Konzepten einer Elitegesellschaft arbeiteten – hier die geistige Elite, dort die infantile Masse – oder den postmodernen Theorien von der Negation des Subjekts im System Gesellschaft auf den Leim gingen und damit als Korrekturinstanz dieses Systems ausfielen. Luhmanns Systemtheorie, auf die hier angespielt wird, hat aber auch gewichtige Argumente für die tatsächliche Entmachtung des Subjekts in der Gesellschaft aufgeboten, die nicht einfach ignoriert werden können. Und unterschlagen werden sollte auch nicht, dass Luhmanns Theorie der Gesellschaft durchaus Korrekturmöglichkeiten gesellschaftlicher Systeme vorsieht – etwa durch den Protest sozialer Bewegungen wie der Grünen.
Über solch kleinere Schwächen wie diese in der Argumentation eines Beitrages sieht man aber gerne hinweg, wenn man liest, was Heinz und Hannelore Schlaffer zu diesem Buch beigesteuert haben. Heinz Schlaffers akademische Glossen über den Geist der Geisteswissenschaften, die ursprünglich für die „Frankfurter Rundschau” verfasst wurden, konfrontieren die Idee der Universität mit ihrer aktuellen Wirklichkeit und gewähren so einen schonungslosen Blick auf das, was Professoren seit einiger Zeit als den Mangel an Studierfähigkeit heutiger Akademiker beklagen. Dem steht Frau Schlaffer mit ihren Reflexionen über das Glück der größten Zahl, die heute Wirklichkeit für die meisten Menschen erschließt, in nichts nach. Beispiel gefällig? „Die Preisgelder der Sportler und ihre Einnahmen für Werbungen sind Mittel einer volkstümlichen Metaphysik: Sie lehren das Staunen in einer götterlosen Zeit." In ihrer genauen Beobachtung, gedanklichen Schärfe und pointierten Stilistik sind diese Beiträge zugleich ein schönes Beispiel für Intelligenz in schriftlicher Form. Aber man wäre heute ja auch schon mit viel weniger zufrieden.
„Strategien der Verdummung. Infantilisierung in der Fun-Gesellschaft”. Herausgegebn von Jürgen Wertheimer und Peter V. Zima. Beck’sche Reihe.169 Seiten. 19,90 Mark.
(Erschienen im „Darmstädter Echo“ am 23. 7. 2001)
