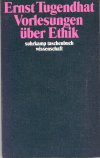 Mit der Moral scheint es in unserer modernen Gesellschaft nicht eben zum Besten zu stehen. Allenthalben wird heute über den Verlust an verbindlichen Werten für Jugendliche geklagt, von denen nicht wenige derzeit mit Ausschreitungen gegen Ausländer und anderen schlimmen Taten unschön auf sich aufmerksam machen.
Mit der Moral scheint es in unserer modernen Gesellschaft nicht eben zum Besten zu stehen. Allenthalben wird heute über den Verlust an verbindlichen Werten für Jugendliche geklagt, von denen nicht wenige derzeit mit Ausschreitungen gegen Ausländer und anderen schlimmen Taten unschön auf sich aufmerksam machen.
Aber auch die Politiker, die in Sonntagsreden gerne die Moral hochleben lassen, erweisen sich im Alltag immer weniger als moraltauglich. Die Fälle von Korruption in der Politik häufen sich (oder werden nur vermehrt von einer aufmerksam gewordenen Öffentlichkeit aufgedeckt?). Fast ist man schon geneigt zu sagen, dass Politik und Korruption eine feste Verbindung eingegangen sind.
Moralische Desorientierung bis hin zum lack of moral sense (Fehlen einer moralischen Empfindung) sind ohne Zweifel das Ergebnis einer hochgradig aufgeklärten Gesellschaft, in der religiöse und traditionelle Begründungsinstanzen für moralische Normen nicht mehr oder nurmehr für eine verschwindende Minderheit zur Verfügung stehen. Deshalb sind auch die Anstrengungen vornehmlich konservativer Gesellschafts- und Kulturpolitiker, dem Sittenverfall mit einer Restitutierung traditioneller Moralkonzepte beizukommen, vergebliche Mühe. Heißt das aber, dass jegliche Versuche, universelle ethische Normen heute begründen zu wollen, im Kern zum Scheitern verurteilt sind, weil unsere Gesellschaft mehr als je zuvor eine von Individuen ist? Eines zumindest ist sicher: Es gibt nach wie vor Menschen, die im zwischenmenschlichen wie im politischen Bereich moralisch urteilen und handeln. Eint diese Menschen noch ein gemeinsamer moralischer Nenner jenseits der Verbindlichkeit von religiösen und traditionellen Normen? Oder vertritt jeder von ihnen nur noch seine ganz individuelle Moral ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit?
Solche Fragen stehen im Zentrum von Ernst Tugendhats Vorlesungen über Ethik, der vorab zwei grundlegende Einschränkungen hinsichtlich der Begründbarkeit einer modernen Moral macht: Es sei weder möglich, den Amoralismus zu widerlegen, noch könne es eine absolute Begründung eines postmetaphysischen Moralkonzepts geben. Möglich sei nur, ein Moralkonzept in der argumentativen Auseinandersetzung mit anderen Konzepten als das plausibelste (bestbegründete) zu erweisen. So besteht denn auch Tugendhats Buch über weite Strecken aus kritischen Analysen prominenter ethischer Theorien aus fast zweitausend Jahren Kulturgeschichte. Von Aristoteles über Kant, Hegel, Schopenhauer, die Diskursethik bis zu den Spielarten des Utilitarismus spannt sich der Bogen bemerkenswerter Versuche, Moral als intersubjektiv gültiges Regelsystem des Zusammenlebens der Menschen zu begründen. Lesenswert!
Ernst Tugendhat: „Vorlesungen über Ethik”. Frankfurt 1996. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 399 Seiten, 27,80 DM
