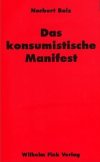 „Das konsumistische Manifest" von Norbert Bolz verbindet mehr mit den Theoretikern des Marxismus als nur die ironische Adaption eines Buchtitels. Zumindest die Hoffnung auf die humanisierende Wirkung des kapitalistischen Marktes teilt der Philosoph des Liberalismus mit dem Großkritiker des Kapitals.
„Das konsumistische Manifest" von Norbert Bolz verbindet mehr mit den Theoretikern des Marxismus als nur die ironische Adaption eines Buchtitels. Zumindest die Hoffnung auf die humanisierende Wirkung des kapitalistischen Marktes teilt der Philosoph des Liberalismus mit dem Großkritiker des Kapitals.
Dass der Konsumismus seine Frieden stiftende Aktivität auf die gesamte Welt ausdehnen möge, darin sieht Bolz die einzige Möglichkeit, wie der Konflikt zwischen der westlich-kapitalistischen Welt und dem islamischen Fundamentalismus nach dem 11. September zu entschärfen sei.
Denn seine Grundthese lautet: „Im Terror islamischer Fundamentalisten manifestiert sich ein Antiamerikanismus, gegen den die westliche Welt keinen erfolgreichen Krieg führen kann.” Bolz empfiehlt stattdessen die Infizierung der Risikostaaten mit dem konsumistischen Virus, denn in deren Hass auf Amerika und den westlich-kapitalistischen Lebensstil sieht er im Wesentlichen das Ressentiment der Ausgeschlossenen. Weil die modernen Gesellschaften eine Politik des Ausschließens großer Teile der Welt betrieben, suchten viele Zuflucht und Heil im religiösen Fundamentalismus, der den Menschen verspreche, ihnen den Preis der Modernität zu ersparen: „Sicherheit und Gewissheit statt Freiheit und Ungewissheit."
Da ist gewiss was dran, und da es Bolz versteht, den Leser mit stilistischer Raffinesse zu umgarnen, merkt man gar nicht mehr, dass er als Forderung nur in philosophisches Gewand kleidet, was seit Jahr und Tag pragmatische Politik im Westen zu erreichen versucht: dort für mehr Wohlstand zu sorgen, wo die wirklich Armen leben. Und tatsächlich: Wo Menschen sich dem Luxus hingeben können zu überlegen, was sie als Nächstes kaufen wollen, kommen sie nicht mehr auf die Idee, Krieg zu führen.
Doch leider, so muss Bolz feststellen, neige der Führer der westlichen Welt, Amerika, im Kampf gegen den islamischen Terrorismus seinerseits zu fundamentalistischen Reaktionen – für Bolz ein fataler Vorgang und zugleich ein Grund, einmal philosophisch gründlich die Vorzüge unserer Gesellschaftsverfassung herauszuarbeiten, die nicht universalistisch oder gar fundamentalistisch missverstanden werden dürfe: als alleinseligmachende Weltanschauung mit privilegiertem Zugang zur Wahrheit. Während viele aus dem linksintellektuellen Lager schon länger über einen Werteverlust der modernen Gesellschaft Klage führen, feiert Bolz deren spezifischen Werteverzicht. „Dass sie nicht mehr zu bieten hat als formale Demokratie, Liberalismus und soziale Marktwirtschaft, ist gerade das Geheimnis ihrer Stärke." Da mögen die Entfremdungskritiker dem System des kapitalistischen Wirtschaftens vorwerfen, dass es die Menschen leidenschaftsloser, trockener und berechenbarer mache – Bolz kontert diesen Vorwurf mit den Worten „Sie wurden auf Zivilisationstemperatur gebracht". Für ihn ist das die Grundbedingung einer friedvollen Welt.
Darüber lässt sich gewiss trefflich streiten, weil die kapitalistische Expansion ja unzweifelhaft nicht nur Segen über die Menschheit gebracht hat und der Überlebenskampf im Kapitalismus bis heute seine individuellen Opfer fordert. Doch davon unberührt singt Bolz auch noch das Loblied des Geldes. „Wo Geld die Welt regiert, bleibt uns der Terror von nackter Faust und guter Gesinnung erspart." Das mag wohl so sein, wird aber diejenigen nicht trösten, die zu wenig davon haben, um unter kapitalistischen Bedingungen ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Und auch im oftmals verteufelten Konsum, der die Menschen zur Oberflächlichkeit erziehe, kann Bolz nichts Verwerfliches entdecken. Im Gegenteil. Für ihn wird der Konsum im postmodernen Zeitalter gar zur Ersatzreligion, zum „Medium der Wiederverzauberung der entzauberten Welt". Für Kulturkritik, die hinter den Erscheinungen der Warenwelt die wahre Welt aufzudecken versucht, scheint da kein Platz mehr zu sein.
Da fragt man sich: Was ist „Das konsumistische Manifest"? Eine stellenweise beeindruckende Philosophie des Wirtschaftsliberalismus oder nur Ausdruck dessen, dass philosophische Reflexion im postmodernen Zeitalter sich mit substanzieller Argumentation völlig bedeckt hält. Zumindest das wird bei der Lektüre klar: Bolz erwähnt anfänglich die Folgelasten der Modernisierung und die Schicksale der Globalisierungsopfer, im Fortgang seiner Ausführungen zur Stärke unseres Gesellschaftssystems spielen sie aber keine Rolle mehr. Ob diese Einseitigkeit der Verbreitung des konsumistischen Virus in der Welt förderlich ist? Und was hätte Marx zu all dem gesagt?
Norbert Bolz: „Das konsumistische Manifest”. Verlag Wilhelm Fink, 160 Seiten, 10 Euro
(Erschienen im „Darmstädter Echo“ am 24. 3. 2003)
