
Luhmanns Protest
 „Ich weigere mich zu glauben, dass ein starkes Engagement sich durch Dürftigkeit des Denkens ausweisen muss.“ Wer sich so kluge Gedanken über die Gesellschaft machen kann wie der deutsche Soziologe Niklas Luhmann, dem mag man nachsehen, wenn er etwas genervt auf diejenigen reagiert, die eben noch nicht die Abstraktionshöhe seines Denkens erreicht haben.
„Ich weigere mich zu glauben, dass ein starkes Engagement sich durch Dürftigkeit des Denkens ausweisen muss.“ Wer sich so kluge Gedanken über die Gesellschaft machen kann wie der deutsche Soziologe Niklas Luhmann, dem mag man nachsehen, wenn er etwas genervt auf diejenigen reagiert, die eben noch nicht die Abstraktionshöhe seines Denkens erreicht haben.
Mehr Langeweile!
 Obwohl die Anzahl der Festivals, Events und traditionellen Veranstaltungen hierzulande in den letzten Jahren so zugenommen hat, dass eine Steigerung kaum mehr vorstellbar scheint, ist die Langeweile noch immer nicht besiegt.
Obwohl die Anzahl der Festivals, Events und traditionellen Veranstaltungen hierzulande in den letzten Jahren so zugenommen hat, dass eine Steigerung kaum mehr vorstellbar scheint, ist die Langeweile noch immer nicht besiegt.
Tugendhats Moralvorlesungen
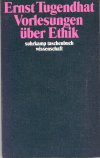 Mit der Moral scheint es in unserer modernen Gesellschaft nicht eben zum Besten zu stehen. Allenthalben wird heute über den Verlust an verbindlichen Werten für Jugendliche geklagt, von denen nicht wenige derzeit mit Ausschreitungen gegen Ausländer und anderen schlimmen Taten unschön auf sich aufmerksam machen.
Mit der Moral scheint es in unserer modernen Gesellschaft nicht eben zum Besten zu stehen. Allenthalben wird heute über den Verlust an verbindlichen Werten für Jugendliche geklagt, von denen nicht wenige derzeit mit Ausschreitungen gegen Ausländer und anderen schlimmen Taten unschön auf sich aufmerksam machen.
Der Geist der Lyrik
 Kennen Sie das? Sie lesen, vielleicht anlässlich eines Lyrikwettbewerbs, über den in der Zeitung berichtet wird, ein darin abgedrucktes modernes Gedicht des Siegers – und verstehen nichts. Sie fragen sich dann wahrscheinlich, ob es an Ihrer mangelnden literarischen Kompetenz liegt, dass Sie mit diesem Gedicht nichts anfangen können. Denn wenn sein Verfasser als preiswürdig empfunden wurde, muss es ja bedeutungsvoll sein.
Kennen Sie das? Sie lesen, vielleicht anlässlich eines Lyrikwettbewerbs, über den in der Zeitung berichtet wird, ein darin abgedrucktes modernes Gedicht des Siegers – und verstehen nichts. Sie fragen sich dann wahrscheinlich, ob es an Ihrer mangelnden literarischen Kompetenz liegt, dass Sie mit diesem Gedicht nichts anfangen können. Denn wenn sein Verfasser als preiswürdig empfunden wurde, muss es ja bedeutungsvoll sein.
Schlaffers „Poesie und Wissen“
 Dass, was allzu selbstverständlich ist und deshalb oft gar nicht bemerkt wird, Anlass sein kann für Fragen, die weitreichende Antworten nach sich ziehen und so den wissenschaftlichen Fortschritt befördern können – dafür liefert einen neuerlichen Beweis das jüngst erschienene Buch „Poesie und Wissen" von Heinz Schlaffer, der im Vorwort bekennt, schon lange an den Geschäften der Literaturwissenschaft beteiligt gewesen zu sein, „ehe ich mich darüber zu verwundern begann, dass es Institutionen und Personen gibt, die den Auftrag haben, über so etwas Unernstes wie die Erfindungen von Dichtern, über Fiktionen also, ernsthaft nachzudenken".
Dass, was allzu selbstverständlich ist und deshalb oft gar nicht bemerkt wird, Anlass sein kann für Fragen, die weitreichende Antworten nach sich ziehen und so den wissenschaftlichen Fortschritt befördern können – dafür liefert einen neuerlichen Beweis das jüngst erschienene Buch „Poesie und Wissen" von Heinz Schlaffer, der im Vorwort bekennt, schon lange an den Geschäften der Literaturwissenschaft beteiligt gewesen zu sein, „ehe ich mich darüber zu verwundern begann, dass es Institutionen und Personen gibt, die den Auftrag haben, über so etwas Unernstes wie die Erfindungen von Dichtern, über Fiktionen also, ernsthaft nachzudenken".
Zum Faschismus hin offen
 „(. . .) jene ungeheure Energie der Größe zu gewinnen, um, durch Züchtung und anderseits durch Vernichtung von Millionen Mißrathener, den zukünftigen Menschen zu gestalten und nicht zu Grunde zu gehen an dem Leid, das man schafft, und dessen Gleichen noch nie da war!" „Die Schwachen und Mißrathenen sollen zu Grunde gehen: (. . .) Und man soll ihnen noch dazu helfen." Sätze wie diese aus der Feder des Philosophen Friedrich Nietzsche scheinen den schon früh geäußerten Verdacht von dessen geistiger Nähe zum Nationalsozialismus aufs Schönste zu bestätigen.
„(. . .) jene ungeheure Energie der Größe zu gewinnen, um, durch Züchtung und anderseits durch Vernichtung von Millionen Mißrathener, den zukünftigen Menschen zu gestalten und nicht zu Grunde zu gehen an dem Leid, das man schafft, und dessen Gleichen noch nie da war!" „Die Schwachen und Mißrathenen sollen zu Grunde gehen: (. . .) Und man soll ihnen noch dazu helfen." Sätze wie diese aus der Feder des Philosophen Friedrich Nietzsche scheinen den schon früh geäußerten Verdacht von dessen geistiger Nähe zum Nationalsozialismus aufs Schönste zu bestätigen.